DEINE SPENDE KANN LEBEN RETTEN!
Mit Amnesty kannst du dort helfen, wo es am dringendsten nötig ist.
DEINE SPENDE WIRKT!
Zurück zu den Wurzeln
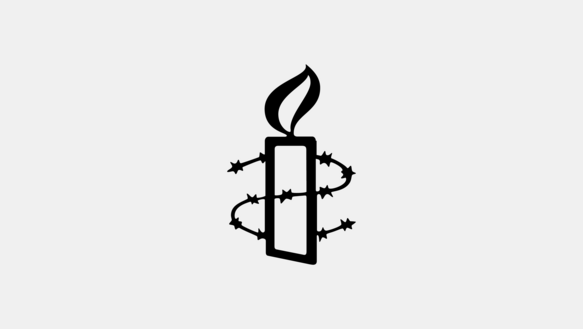
Weltweit kaufen Investor*innen Millionen Hektar fruchtbaren Bodens auf und zerstören damit die Lebensgrundlage der ansässigen Bevölkerung. Doch es regt sich auch Widerstand gegen den Landraub.
Von Annette Jensen
Viele Menschen im Senegal sind inzwischen sehr aufmerksam. Entdecken sie Hinweise, dass jemand große Flächen Land kaufen will, informieren sie das Netzwerk von ENDA Pronat. Verdichten sich die Zeichen, organisieren sie Protestmärsche unter dem Motto: "Hände weg von unserer Erde". Die Organisation ENDA Pronat ist in dieser Form wohl einmalig. "Bei uns arbeiten Soziologen, Juristen, Bauern und Agrarexperten eng zusammen", sagt die Koordinatorin der Organisation Mariam Sow. Oberstes Ziel ist es, eine Wende in Richtung einer naturverträglichen Landwirtschaft voranzutreiben und der Bevölkerung die Chance zu eröffnen, über Ernährungsweise und Lebensmittelproduktion selbst zu bestimmen.
Mehr als die Hälfte der senegalesischen Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft – und doch muss das Land einen Großteil der Grundnahrungsmittel wie Weizen und Reis importieren. In den 1970er Jahren setzte die Regierung auf die "grüne Revolution" und förderte den Erdnussexport. Die Bäuerinnen und Bauern wurden gedrängt, Hochertragssaatgut einzusetzen. Subventionierte Chemikalien gab es im Doppelpack dazu. Die Folgen waren fatal: Viele Familienbetriebe verschuldeten sich.
Dass Boden Eigentum sein kann, war im vorkolonialen Senegal unvorstellbar. Die Flächen wurden von den Dorfältesten verteilt und nach Gewohnheitsrecht bewirtschaftet. Seit 1964 gilt Land als "Nationaldomäne". Die Kommunen sollen es zeitlich befristet an ortsansässige Personen vergeben – so das Gesetz. Dennoch haben sich inzwischen internationale Investor*innen in der Landwirtschaft breit gemacht. Während die Einheimischen vielfach keine Dokumente über das zugeteilte Land vorweisen können, bringen ausländische Interessent*innen hochbezahlten juristischen Beistand mit. Mal setzen sie die Gemeindevertretungen unter Druck, mal holen sie sie mit ins Boot. Bereits vor zehn Jahren war knapp ein Sechstel der landwirtschaftlichen Flächen Senegals in ausländischer Hand.
2017 sprach die Regierung der marokkanischen Firma Afri Partners 100 Quadratkilometer fruchtbarer Äcker im Norden des Landes zu – auf Kosten der dort lebenden 36.000 Bäuerinnen und Bauern. Ihre Rechte auf Wohnen, Nahrung und Selbstbestimmung wurden schlicht übergangen. ENDA Pronat organisierte gewaltfreien Widerstand. Der Oberste Gerichtshof erklärte die Landvergabe an Afri Partners schließlich für ungültig, sodass die heimische Bevölkerung bleiben konnte. Auch zwei weitere Prozesse wurden mithilfe von ENDA Pronat gewonnen, und einige Landverkäufe konnten bereits im Vorfeld verhindert werden. Die Organisation deckte zudem mehrere Fälle von Geldwäsche und enge Verbindungen zwischen Politiker*innen und Investor*innen auf.
Die erste Bodenrechtskommission, die Senegals Regierung vor einigen Jahren einberufen hatte, war noch ganz auf die Interessen großer Investor*innen zugeschnitten. Nachdem bei Protesten mehrere Menschen starben, sah sich Präsident Macky Sall gezwungen, eine neue Kommission zu berufen, zu der er auch ENDA Pronat einlud. Außerdem ergab eine Befragung der Bevölkerung, dass die große Mehrheit im Land die Nationaldomäne beibehalten will und den Verkauf landwirtschaftlicher Flächen an internationale Investor*innen ablehnt. Tatsächlich stehen nun zentrale Positionen von ENDA Pronat im Schlussdokument der Bodenkommission – fast gleichzeitig erließ die Regierung jedoch ein Dekret zur Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen, in denen der Verkauf von Land weiterhin möglich ist.
ENDA Pronat berät nicht nur zu Landrechtsfragen, sondern auch zu Anbaumethoden – und immer sind die Menschen vor Ort in die Aktionen und Forschung eingebunden. Sie bringen ihr traditionelles Wissen ein und dokumentieren den Status quo, wer vor Ort welchen Zugang zu den natürlichen Ressourcen hat. Auf diesem Weg sind vielfältige Netzwerke und Kooperationen entstanden, die von der Dorfebene bis zur Weltbühne reichen. "Unsere Methode ist es, Partner zu überzeugen und die Bevölkerung an Bord zu holen", sagt Mariam Sow.
Dass die Welternährungsorganisation (FAO) die Agrarökologie – eine Landwirtschaft, die sich in die natürlichen Stoffkreisläufe einfügt und auf Kunstdünger und Pestizide verzichtet – inzwischen als ein zentrales Instrument zur Ernährungssicherheit ansieht, ist auch ein Verdienst von ENDA Pronat. Deren wissenschaftliche Abteilung gründete bereits in den 1970er Jahren die internationale Organisation ENDA Tiers Monde, die mittlerweile 24 Mitgliedsorganisationen in elf afrikanischen, lateinamerikanischen und asiatischen Ländern hat. Sie kritisiert die wirtschaftlichen Zustände im globalen Süden als Folge der Kolonialzeit.
Abhängig von Importen
Die starke Abhängigkeit vieler Länder des globalen Südens von Lebensmittelimporten wurde nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg deutlich. Senegals Präsident reiste bereits im Frühjahr 2022 nach Moskau, denn das Land importiert mehr als die Hälfte der benötigten Weizenmengen aus Russland. Weltweit haben Agrarkonzerne Land aufgekauft, um darauf vor allem Tierfutter, Energiepflanzen und Lebensmittel für den Export zu produzieren. So nehmen Länder des globalen Nordens viel mehr Agrarflächen in Anspruch, als im Inland vorhanden sind. Für Deutschland sind das nach Angaben der Organisation WWF etwa 5,5 Millionen Hektar jenseits der eigenen Grenzen. Aber auch der Fleischkonsum in China, der sich binnen 30 Jahren vervierfacht hat, trägt zum Landgrabbing bei.
In Lateinamerika wurden bereits riesige Urwaldflächen gerodet, um Soja anzubauen, das die Futtertröge von Hühnern, Schweinen und Rindern füllt und zum Teil zu Biodiesel verarbeitet wird. "Das Problem des Landgrabbings betrifft eine Vielzahl von Menschenrechten. Dazu gehört das Recht indigener Bevölkerungsgruppen auf freie, vorherige und informierte Zustimmung zu Projekten, die sie betreffen, das Recht auf Wohnen und das Recht auf eine saubere Umwelt", sagt Bea Streicher, Expertin für Wirtschaft und Menschenrechte von Amnesty International Deutschland. Ehemalige Kleinbäuerinnen und -bauern müssen entweder auf den Plantagen arbeiten oder in die Städte ziehen. Die meisten der offiziell 828 Millionen Hungernden weltweit leben heute in ländlichen Regionen.
Dabei ließe sich das Menschenrecht auf Nahrung weltweit umsetzen – wenn anders produziert würde. Die Eat-Lancet-Kommission unter dem Vorsitz des Klimawissenschaftlers Johan Rockström hat 2019 einen "Speiseplan für Mensch und Erde" vorgelegt. Darin stellen 37 internationale Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Disziplinen fest, dass auch eine bis zur Jahrhundertmitte weiter wachsende Menschheit ernährt werden könnte, ohne den Planeten weiter zu ruinieren, wenn es nur noch 14 Gramm rotes Fleisch und 29 Gramm Geflügel pro Person und Tag gäbe. Gegenwärtig liegt der Durchschnittskonsum in Deutschland bei 115 Gramm Schweine- und Rindfleisch und bei 35 Gramm Huhn, Gans oder Ente pro Tag. Auch der Konsum anderer tierischer Produkte wie Milch und Eier müsste deutlich reduziert werden. Dafür kämen mehr Hülsenfrüchte, Nüsse und Gemüse auf den Tisch.
Bereits 2008 wurde der Weltagrarbericht veröffentlicht, den 400 internationale Wissenschaftler*innen im Auftrag von Weltbank und FAO erarbeitet hatten. Er belegt, dass eine kleinteilige, vielfältige, regional angepasste Landwirtschaft viel umweltfreundlicher ist und produktiver sein kann als Monokulturen, die auf extrem viel Kunstdünger und Pestizide angewiesen sind. Die Agrarkonzerne Bayer, Monsanto und BASF, die zunächst an dem Bericht mitgearbeitet hatten, zogen sich zurück, als sich das Ergebnis abzeichnete. 58 Länder unterzeichneten den Weltagrarbericht. Deutschland, die USA, Kanada, Australien und Russland sind nicht darunter.

Landgrabbing – der neue Kolonialismus
Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 sind landwirtschaftliche Flächen äußerst begehrt. Anders als Finanzprodukte ist Boden nicht vermehrbar. Vermögende sehen darin eine sichere Anlagemöglichkeit, weil Nahrungsmittel immer gebraucht werden. Sie sind längst zum Spekulationsobjekt geworden. Als die Preise für Reis, Mais und Weizen 2008 in die Höhe schossen, beflügelte das auch die Fantasie von Investor*innen. So wurden in den vergangenen Jahren weltweit Millionen Hektar Land an reiche Menschen und multinationale Unternehmen verkauft, auf denen nun vor allem gewinnbringende Pflanzen für den Export, sogenannte Cash Crops, und Biotreibstoffe angebaut werden.
Die Bodenpreise sind vielerorts so stark gestiegen, dass Selbstversorger*innen und Kleinbäuerinnen und -bauern nicht mithalten können und ihre Existenzgrundlage verlieren. Doch findet das Landgrabbing längst nicht mehr nur im globalen Süden statt. So haben sich zum Beispiel in Brandenburg die Pacht- und Kaufpreise innerhalb von zehn Jahren verdreifacht. Viele kleinere landwirtschaftliche Betriebe mussten bereits aufgeben. Derweil erwarben Mitglieder der Familie Aldi, die zu den reichsten Familien Deutschlands zählt, Zehntausende Hektar Ackerland in Ostdeutschland, und auch der Bremer Bau- und Immobilienunternehmer Kurt Zech lässt auf riesigen Flächen Mais für Biosprit anbauen.
Am stärksten ist der Konzentrationsprozess beim Landbesitz in Lateinamerika, wie eine Studie von Oxfam belegt. In Kolumbien besitzen 0,4 Prozent der Eigentümer*innen 67 Prozent des produktiven Lands, während 85 Prozent der Kleinbäuerinnen und -bauern sich mit vier Prozent der Flächen begnügen müssen. In Chile und Paraguay sieht es nicht viel anders aus. Den größten Ansturm neuer Investor*innen hat derzeit Afrika zu verkraften, wie die Plattform "Land Matrix" aufzeigt, die Informationen über große Landverkäufe transparent macht (https://landmatrix.org).
Kritiker*innen sehen darin eine neue Welle der Kolonialisierung. Bereits vor 500 Jahren führte Europas Gier nach Zucker zu sozial-ökologischen Katastrophen für Millionen Menschen in Amerika und Afrika. Die ersten Plantagen entstanden in Brasilien, wo bereits um 1600 jährlich 10.000 Tonnen Zucker für den Export produziert wurden. Wenig später wurden auf Barbados sämtliche Bäume gefällt, um Platz für Zuckerrohr und den Brennstoff für die Zuckermühlen zu schaffen. Die Arbeit verrichteten vor allem Sklav*innen aus Afrika, weil ein Großteil der ursprünglichen Bevölkerung Seuchen zum Opfer gefallen war, die Europäer*innen eingeschleppt hatten.
Nachdem die Böden auf Barbados erodierten, verlagerte sich die Zuckerherstellung auf andere karibische Inseln, insbesondere nach Jamaika, und seit dem 19. Jahrhundert nach Kuba. Überall ging der Prozess mit Entwaldung, Austrocknung und einem massiven Verlust fruchtbaren Ackerlands einher. Vor der Ankunft der Europäer*innen hatten in Lateinamerika mehrere Hochkulturen eine zum Teil hochproduktive Landwirtschaft betrieben. In Zentralmexiko konnten Bäuerinnen und Bauern mit ihrer Gartenkultur 15 Menschen pro Hektar ernähren. Im heutigen Deutschland sind es nur vier bis fünf Menschen – was auf den hohen Konsum tierischer Produkte zurückzuführen ist.
Auch in anderen Erdteilen zerstörten die Kolonialherren die Selbstversorgung der heimischen Bevölkerung. In Kenia eignete sich die britische Verwaltung Anfang des 20. Jahrhunderts das fruchtbare Land an und verkaufte es an europäische Siedler*innen. Die traditionellen Agroforstsysteme wurden vernichtet, der Anbau von Sorghum in Kombination mit vielfältigen anderen Nahrungspflanzen wurde durch Mais-, Weizen- und Kaffeekulturen ersetzt. Die Erträge waren vor allem für den Export nach Großbritannien bestimmt. Mit der Umstrukturierung ging die Behauptung einher, die traditionellen Anbaumethoden seien rückständig und unproduktiv im Vergleich zur industrialisierten Landwirtschaft. An dieser falschen Erzählung hat sich bis heute nichts geändert.

Agrarindustrie – Pestizide und Saatgut für den Markt
In den vergangenen Jahrzehnten fand in der Agrarindustrie ein starker Konzentrationsprozess statt. Wenige Konzerne teilen sich den Markt für Pestizide, Saatgut, Dünger und Landmaschinen. Vier Firmen produzieren heute zwei Drittel der weltweiten Agrochemikalien, darunter Bayer und BASF. Beim Saatgut gehört Bayer zu den großen Drei.
In jahrtausendelanger Arbeit züchteten Landwirt*innen immer neue Nutzpflanzen und entwickelten Sorten, die an die jeweiligen Umweltbedingungen angepasst waren. Der Tausch von Samen war selbstverständlicher Teil der Landwirtschaft. Erst im 19. Jahrhundert wurde Saatgut zur Handelsware. Inzwischen sind 75 Prozent der einst existierenden 7.000 Gemüsearten unwiederbringlich verloren. Außerhalb von Nischen werden nur noch etwa 200 Nahrungspflanzen angebaut, wobei neun Kulturen dominieren: Zuckerrohr, Mais, Reis, Weizen, Kartoffeln, Sojabohnen, Ölpalmen, Zuckerrüben und Maniok. Zum Einsatz kommen fast nur noch wenige Hochertragssorten.
Noch Ende der 1960er Jahre waren 99 Prozent der Gemüsesorten samenfest, konnten sich also selbst vermehren. 30 Jahre später traf das nur noch auf 20 Prozent zu. Die große Masse sind heute Hybridsorten, die zwar hohe Erträge bringen, aus deren Samen aber keine oder nur mickrige Pflanzen wachsen. So wurden Landwirt*innen abhängig von der Agrarindustrie. Nur ein kleiner Teil alter Sorten wird in Saatgutbanken aufbewahrt.
Während früher die Pflanzensorten an die jeweiligen natürlichen Bedingungen angepasst waren, wird jetzt durch Dünger, Bewässerung und Agrochemikalien versucht, die jeweilige Umgebung an den Bedarf der Hochertragssorten anzupassen. Ab Mitte der 1990er Jahre entstand mit gentechnisch veränderten Pflanzen ein neues Geschäftsmodell, bei dem Pestizide und patentiertes Saatgut gemeinsam verkauft werden. Der Pflanzenkiller Glyphosat vernichtet alle Gewächse außer genmanipuliertem Mais, Reis, Soja und Raps. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend" ein, sein Einsatz verletzt somit das Recht auf Gesundheit.
In Indien soll es vor der Kolonialisierung etwa 400.000 verschiedene Reissorten gegeben haben – inzwischen wachsen auf 75 Prozent der Flächen zehn Sorten. Dieser genetischen Verarmung will die indische Organisation Navdanya entgegenwirken. Das große Netzwerk aus lokalen Gemeinschaften sichert traditionelle Nutzpflanzen mit dem Ziel, die Unabhängigkeit von Kleinproduzierenden zu bewahren und lokale Märkte zu stärken. Etwa die Hälfte der Bevölkerung des Subkontinents lebt zumindest zum Teil von selbst angebauten Lebensmitteln.
Navdanya betreibt 122 gemeinschaftliche Saatgutbanken in 18 indischen Bundesstaaten und unterrichtet traditionelle Anbaumethoden. Gegründet wurde die Organisation von Vandana Shiva, die mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde und als eine der schärfsten Kritikerinnen der globalen Agrarindustrie gilt. Seit Jahren weist sie darauf hin, dass die großen Saatgutfirmen viele indische Bäuerinnen und Bauern in eine ausweglose Schuldenfalle und letztlich in den Tod getrieben haben. Jedes Jahr nehmen sich Tausende Landwirt*innen in Indien das Leben.
Auch das internationale Bündnis La Via Campesina (Der bäuerliche Weg) engagiert sich für eine Umgestaltung des Agrarsystems hin zu Ernährungssouveränität und -sicherheit. Die inzwischen 200 Millionen Mitglieder sind Kleinlandwirt*innen, Landarbeiter*innen, Landlose und Indigene aus 81 Ländern. Sie fordern den Vorrang von Selbstversorgung und regionalem Handel vor der Orientierung am Weltmarkt.
Arbeitsbedingungen – Ausbeutung für billige Produkte
Palmöl ist das meist produzierte Pflanzenöl weltweit. Es steckt in der Hälfte der Supermarktprodukte: Margarine, Fertigpizza, Gebäck, Tierfutter, Hautcreme und Waschmittel. Auch als Biotreibstoff wird das geschmeidige Fett verwendet. Palmöl ist geschmacksneutral, geruchs- und farblos, lange haltbar – und sehr billig. Wo in Indonesien früher Urwälder standen, erstrecken sich heute riesige Palmölplantagen. Die Arbeitsbedingungen dort sind katastrophal. Nach Angaben der Organisation FIAN sind 70 Prozent der Beschäftigten Gelegenheitsarbeiter*innen und damit keinen Anspruch auf gesetzlich verankerte Arbeitsrechte wie Mindestlohn, menschenwürdige Arbeitszeiten, Krankenversicherung und Mutterschutz. Auch das Recht auf Versammlungs- und Gewerkschaftsfreiheit gilt in der Praxis nicht. Viele Landarbeiter*innen leiden unter Krankheiten infolge des Umgangs mit Pestiziden. Hinzu kommen hohe Akkordanforderungen. "Um die Vorgaben zu erreichen, müssen andere Familienangehörige ebenfalls mitarbeiten, darunter auch Kinder", kritisiert Esther Hoffmann, Indonesien-Expertin von Amnesty International Deutschland.
Viele Kleinbäuer*innen oder Selbstversorger*innen, die früher noch ihre Existenz sichern konnten, müssen sich heute als Tagelöhner*innen auf den Feldern von Großgrundbesitzern verdingen, die für den Weltmarkt produzieren. Auch die weiter praktizierenden kleinen Landwirtschaftsbetriebe beschäftigen Saisonarbeiter*innen. Deren Verhandlungsposition ist äußerst schwach, denn auf dem Land suchen viele Arbeit. Wie hoch die Zahl der ausgebeuteten, äußerst prekär lebenden Landarbeiter*innen weltweit ist, ist unbekannt. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schätzte ihre Zahl bereits vor zehn Jahren auf 300 bis 500 Millionen. Inzwischen sind es mit Sicherheit deutlich mehr.

Landwirtschaft – Verursacher und Opfer der Erderhitzung
"Vor allem die besonders fruchtbaren Böden sind im Visier der Ausländer*innen. Für die heimische Bevölkerung bedeutet das, dass sie nur Zugang zu wenig ertragreichen Böden hat. Die Klimakrise verschärft diese Lage noch zusätzlich", sagt Kristina Hatas, Klimaexpertin von Amnesty International. Obwohl sich großflächige Agrarstrukturen ausbreiten, bewirtschaften auch heute noch 85 Prozent der Bäuerinnen und Bauern weltweit weniger als zwei Hektar. Doch immer häufiger wird ihre Ernte durch Dürre, Stürme oder Überflutungen zerstört. Existenziell gefährdet sind Produzent*innen, die ohnehin in großer Armut leben. "Sehr verwundbar sind auch jene, die sich auf Rat von Regierungen, Konzernen oder Stiftungen auf einzelne Hauptprodukte spezialisieren und Hybridsaatgutsorten einsetzen, die anfälliger sind bei Dürre und Hitze", schreibt die NGO Oxfam.
Die heutige Landwirtschaft ist gleichermaßen Verursacher und Opfer der Erderhitzung. In einem 2019 veröffentlichten Sonderbericht ging der Weltklimarat davon aus, dass Landnutzung, Land- und Forstwirtschaft für 23 Prozent der Treibhausgase verantwortlich sind. Durch tiefes Pflügen und schwere Maschinen entweicht der im Boden gebundene Kohlenstoff in die Atmosphäre. Der Einsatz von synthetischem Dünger verschärft das Problem, weil er mit hohem Energieaufwand aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird. Pro Kilo Chemiedünger werden etwa zwei Kilogramm CO2 freigesetzt. Bei Düngung mit Kompost und Mist entstehen diese Probleme nicht.
Die Produktion von Fleisch und anderen tierischen Produkten ist ein weiterer zentraler Faktor der Klimaerwärmung. Die Abholzung von Wäldern zugunsten von Äckern und Weiden setzt große Mengen Kohlenstoff frei. Hinzu kommen die Methanemissionen aus den Mägen von Wiederkäuern, sofern sie mit Kraftfutter versorgt werden. Dem Amnesty-Bericht "Stop burning our rights" zufolge sind Argentinien, Australien, Brasilien, die EU, Kanada, Neuseeland und die USA für 43 Prozent der klimaschädlichen Gase durch tierische Nahrungsmittel verantwortlich, obwohl sie nur 15 Prozent der Weltbevölkerung beherbergen.









