DEINE SPENDE KANN LEBEN RETTEN!
Mit Amnesty kannst du dort helfen, wo es am dringendsten nötig ist.
DEINE SPENDE WIRKT!
Bakschisch as usual
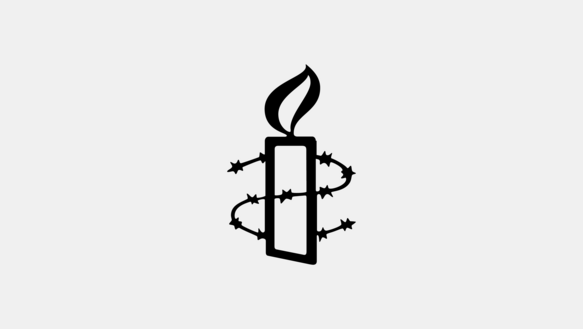
Gegen das französische Bauunternehmen Lafarge wird wegen Beihilfe zu Verbrechen der Terrororganisation Islamischer Staat ermittelt.
Von David Philippot
"Lafarge hat mein Leben, meine Karriere zerstört", sagt Mohammed* und verzieht den Mund zu einem traurigen Lächeln. Er bedauere sehr, vor acht Jahren dem Angebot eines Freundes gefolgt zu sein, für den französischen Zementhersteller im Nordosten Syriens zu arbeiten. Das Jobangebot des globalen Branchenführers war für den jungen syrischen Vater höchst attraktiv: Es erlaubte ihm, seine Familie aus dem Konfliktgebiet nahe der türkischen Grenze in Sicherheit zu bringen.
Jahre nach der folgenschweren Entscheidung spricht er zum ersten Mal mit einem Journalisten. Andere Opfer, die wie er von der Menschenrechtsorganisation Sherpa und dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) unterstützt werden, ziehen es vor, stumm und unsichtbar zu bleiben, eingeschüchtert von der Macht des Gegners. Höflich und in präzisem Englisch erzählt der Ingenieur in einem Café in Berlin, wie sein Leben durch den Krieg und die Verachtung seines ehemaligen Arbeitgebers aus dem Ruder lief.
Der Schutzstatus, den er seit 2016 in Deutschland genießt, erlaubt ihm zwar, eine Arbeit aufzunehmen. Doch bei der Arbeitssuche erfährt er eine Abfuhr nach der anderen, obwohl es hierzulande an Ingenieuren mangelt: "Immer wenn meine Gesprächspartner in meinem Lebenslauf 'Lafarge und Syrien' lesen, rümpfen sie die Nase. Diese Scharte lässt sich nicht mehr auswetzen", sagt er. Dabei hat er nur ein Jahr für die französische Gruppe gearbeitet, von Sommer 2011 bis Sommer 2012.
Der Grund: Seit 2016 untersucht die französische Justiz die Aktivitäten im Zementwerk Jalabiya im Norden Syriens, das von Lafarge Cement Syria bis 2014 betrieben wurde. Das Unternehmen hatte schon zuvor eingeräumt, dort nach Beginn des Krieges 2012 bewaffnete Gruppen bezahlt zu haben, um den Betrieb der Fabrik aufrechterhalten zu können. Französische Geheimdienste wussten laut Medienberichten offenbar bereits länger davon. Sherpa spricht von 13 Millionen Euro an Schutzgeldern, die über mehrere Jahre geflossen sein sollen. In einem Bericht der Unternehmensgruppe Lafarge-Holcim werden fünf Millionen genannt.
Anders als die etwa hundert nichtsyrischen Angestellten, die von der Firmenleitung nach Ausbruch der Kämpfe außer Landes geschleust wurden, blieben die rund 250 syrischen Arbeiter im Sommer 2012 vor Ort – was Mohammed zu Nachfragen über den Evakuierungsplan veranlasste. "Der Sicherheitschef der Firma, der Norweger Jacob Waerness, erklärte mir daraufhin, dass ich das Unternehmen umgehend verlassen könne, wenn ich nicht zufrieden sei – was ich auch gemacht habe, aber nur, um meine Familie in der Türkei in Sicherheit zu bringen".
Dass es damals bereits zu Entführungen durch lokale Milizen kam, war der Unternehmensführung bewusst – es wurden Lösegelder gezahlt, aber auch Mitarbeiter ohne Abfindung entlassen, wenn sie nicht zur Arbeit erschienen. Das belegen E-Mails zwischen der Firmenzentrale in Paris und Lafarge Cement Syria (LCS), das zu 98,7 Prozent im Besitz von Lafarge ist. Nicht nur rivalisierende Milizen machten das Leben für die einheimischen Lafarge-Mitarbeiter zur Hölle; das Unternehmen zwang sie außerdem dazu, in einer 45 Kilometer entfernten Siedlung in Manbij zu leben, einer Stadt, die regelmäßig Ziel syrischer Luftangriffe war.
Wie richtig seine Entscheidung war, Syrien früh zu verlassen, begriff Mohammed im September 2014, als es rund dreißig Kollegen gerade noch schafften, die Fabrik zu verlassen, bevor sie von Milizionären des Islamischen Staats (IS) gestürmt wurde. Den Erfolg der Evakuierung schrieb sich indes Frédéric Jolibois zu, Direktor der Lafarge-Tochtergesellschaft LCS, der die Fabrik in Jalabiya von Kairo aus leitete: "Trotz der Komplexität der Situation und der extremen Dringlichkeit, mit der wir konfrontiert waren, ist es uns gelungen, unsere Mitarbeiter sicher aus dem Werk zu holen", schrieb er an die Konzernzentrale. "Ich bin überzeugt, dass wir die letzte Schlacht gewinnen werden."
Die findet nun vor Gericht in Paris statt, nachdem die französische Justiz im Juni 2016 Ermittlungen gegen mehrere frühere Manager des Unternehmens einleitete. Ihnen wird "Terrorismusfinanzierung", "Embargoverletzung" und "Gefährdung des Lebens anderer" vorgeworfen. Eine juristische Besonderheit des französischen Rechts erlaubt es, dass Lafarge selbst als juristische Person mit denselben Anklagepunkten belastet wird – und das Unternehmen im Falle einer Verurteilung ebenfalls strafrechtlich belangt werden könnte.
Als "historische Premiere", bezeichnet Claire Tixeire vom ECCHR deshalb auch die Ermittlungen. "Das ist das erste Mal, dass ein multinationales Unternehmen – die Muttergesellschaft – auf diese Weise angeklagt wird."
Für die Durchsetzung ethischer Unternehmensverantwortung sei das sehr wichtig, schließlich stehe damit das Geschäftsmodell des gesamten Unternehmens vor Gericht, "das Streben nach Gewinn um jeden Preis". Rund 680 Millionen Dollar hatte die Lafarge-Gruppe einst in Syrien investiert, um "das modernste Zementwerk im Nahen Osten" zu errichten.
Um dieses Kapital nicht zu gefährden, kämpft die Lafarge-Gruppe nun mit den besten Anwälten der französischen Hauptstadt gegen eine Verurteilung – im November gelang ihr dabei zumindest ein Teilerfolg: Ein Pariser Berufungsgericht hob die schwerwiegendste Anklage, "Mittäterschaft bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit", auf.
Doch der Prozess geht weiter, und damit das juristische Ringen um die Frage, inwieweit Geschäfte skrupellos weiterbetrieben werden können, obwohl Menschenrechte dabei massiv verletzt werden. Schließlich war Lafarge das einzige ausländische Unternehmen, das nach Ausbruch des Krieges im Norden Syriens blieb – nicht zuletzt, um nach Ende der Kämpfe als erstes bereitzustehen, um am Wiederaufbau zu verdienen.
Eine strategische Entscheidung, die der Mutterkonzern durch Schmiergeldzahlungen an lokale Milizen eifrig beförderte. Die 13 Millionen Euro, die allein zwischen 2011 und 2013 an Bakschisch geflossen sein sollen, wurden vermittelt durch den nach Ausbruch des Aufstands nach Paris geflohenen Geschäftsmann Firas Tlass, den Sohn des ehemaligen Verteidigungsministers. Die Schmiergeldzahlungen gingen auch weiter, als der Islamische Staat im Juni 2014 die Kontrolle über die Region übernahm und die Errichtung eines Kalifats verkündete – unter Verstoß gegen ein europäisches Embargo und eine UN-Resolution, die finanzielle Beziehungen zu terroristischen Gruppen verbietet.
Drei der angeklagten Führungskräfte haben inzwischen den Konzern verlassen. Der Kassationsgerichtshof muss nun darüber entscheiden, ob sich Lafarge vorsätzlich an den Verbrechen beteiligt hat, was der Konzern bestreitet. Oder ob er, wie das ECCHR behauptet, wissen musste, dass das eigene betrügerische Handeln die Verbrechen begünstigte. Es wäre das erste Mal, dass für derart schwerwiegende Taten ein multinationaler Konzern zur Rechenschaft gezogen wird. Mohammed hofft, dass Lafarge verurteilt wird – "nicht als Akt persönlicher Rache, sondern im Namen der Gerechtigkeit": "Ich möchte, dass sie bezahlen, denn das Geld, das sie an Terroristen gezahlt haben, hat Frauen zu Witwen und Kinder zu Waisen gemacht."
* Name von der Redaktion geändert.








