DEINE SPENDE KANN LEBEN RETTEN!
Mit Amnesty kannst du dort helfen, wo es am dringendsten nötig ist.
DEINE SPENDE WIRKT!
"Es war reine Neugier"
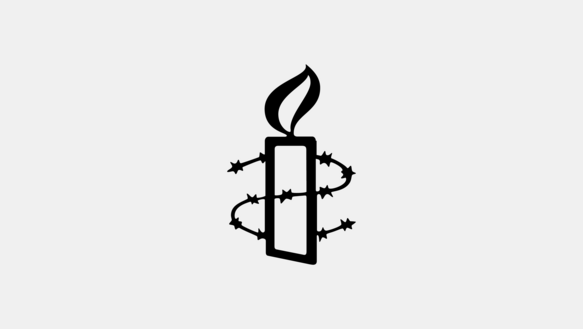
Die Fondation Cartier gilt als einer der wichtigsten Ausstellungsorte für die zeitgenössische Kunst indigener Völker. Ein Gespräch mit dem Direktor der Sammlung Hervé Chandès und dem Anthropologen Bruce Albert über unterschiedliche Bildkonzepte und die Lage der Yanomami im Amazonasgebiet.
Interview: Brigitte Werneburg
Sie unterscheiden sich von anderen Institutionen, die zeitgenössische Kunst zeigen, weil Ihr Schwerpunkt auf indigener Kunst liegt. Wie kam es dazu?
Hervé Chandès: Es war reine Neugier. Die Fondation wollte von Anfang an ein Ausstellungsort sein, an dem alle Künste und Künstler*innen zusammenkommen und die gleiche Aufmerksamkeit erhalten. Konkreter Anstoß war jedoch meine Begegnung mit der Fotografin und Aktivistin Claudia Andujar in São Paulo. Sie hat ihr fotografisches Werk und ihr Leben der Rettung der Yanomami gewidmet, einer indigenen Gruppe im brasilianischen Amazonasgebiet, die etwa 35.000 Menschen umfasst. Claudia Andujar stellte mich dem französischen Anthropologen Bruce Albert vor. Das war eine wichtige Begegnung für mich. Albert kennt diese Menschen und ihren Überlebenskampf.
Wie sah Ihre erste Zusammenarbeit aus?
Bruce Albert: Zunächst lud ich Hervé Chandès ein, mich zu einem großen Yanomami-Treffen zu begleiten. Im Dezember 2000 versammelten sich etwa 300 Yanomami eine Woche lang im Dorf des Schamanen Davi Kopenawa, der die Organisation Hutukara Associação Yanomami gegründet hat.
Chandès: Danach war mir klar, dass ich eine Ausstellung über die Yanomami machen muss. So entstand "Yanomami. Spirit of the Forest" im Jahr 2003.
Albert: Die Ausstellung war in ihrer Anlage ganz neu und sehr abenteuerlich. Das Bild spielt in der Yanomami-Kultur eine wichtige Rolle, allerdings ausschließlich als mentales Bild. Deshalb dachten wir, dass es interessant wäre, westliche Künstler*innen, die materielle Bilder produzieren, mit den Yanomami-Schamanen zusammenzubringen, um sich über ihre unterschiedlichen Bildkonzepte auszutauschen. Die westlichen Künstler*innen besuchten dann ihre Gastgeber*innen im Amazonasgebiet.
Wie kommen Sie mit indigener Kunst in Kontakt?
Chandès: Auf die Künstler*innen aus Paraguay, die 2019 in der Ausstellung "Southern Geometries" vertreten waren, machte uns der Direktor des Muséo del Barro, Ticio Escobar, aufmerksam. Ich wurde dann in die Ateliers weiterer Künstler*innen mitgenommen und ihnen vorgestellt. Eigentlich gibt es immer jemanden, der einen Vorschlag oder eine Anregung hat und dem ich vertraue.
Albert: Die Fondation hat inzwischen eine gewisse Vorbildfunktion für südamerikanische Kunstinstitutionen. Was in Paris gezeigt wird, muss interessant sein, so denkt man in Brasilien. So präsentierte das Instituto Tomie Ohtake in São Paulo 2014 – zehn Jahre nach der Yanomami-Ausstellung in Paris – zum ersten Mal indigene Kunst. Inzwischen gibt es einen regelrechten Boom. Im vergangenen Jahr wurden mit Daiara Tukano, Sueli Maxakali, Jaider Esbell, Uýra und Gustavo Caboco fünf indigene Künstler*innen zur Biennale von São Paulo eingeladen. Das ist ein schöner Erfolg seit unseren Anfängen vor 20 Jahren.
Wie präsentieren Sie indigene Kunst?
Albert: Unser Ziel war es, die indigene Kunst zu dekolonisieren und sie nicht mehr in die Schublade "wildes Denken" zu stecken. Indigene Kunst ist genauso zeitgenössisch wie die Kunst, die in London oder Paris entsteht. Als erstes haben wir mit der kolonialen Vorstellung gebrochen, dass indigene Kunst nur in ethnografischen Museen Platz hat. Wir haben sie in einem modernen weißen Raum gezeigt, wo eben zeitgenössische Kunst ausgestellt wird.
Chandès: Wir sammeln die indigene Kunst, die wir zeigen, in derselben Weise wie zeitgenössische Kunst im Allgemeinen. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass wir mit den indigenen Künstler*innen in direktem Kontakt stehen. Das Geld geht an sie, es gibt keine Galerien oder Kunsthändler dazwischen.
Ihre Ausstellungen basieren also auf Ihrer Sammlung?
Chandès: Ja, unsere Sammlung macht es auch möglich, unsere Ausstellungen auf Reisen zu schicken. Das ist für die indigenen Künstler*innen und ihre Gruppen sehr wichtig, weil sie sich auf diese Weise ausdrücken können, sichtbar werden und sich über ihr Leben und ihre Anliegen austauschen können. Wir wissen, dass diese Ausstellungen große Aufmerksamkeit erregen. Derzeit präsentieren wir in Lille "Living Worlds" mit Werken aus unserer Sammlung. In den Arbeiten geht es darum, dem Anthropozentrismus Grenzen zu setzen, um ein neues Zusammenleben mit den Pflanzen und Tieren auf dieser Erde zu ermöglichen. Und dann planen wir bereits für New York, wo im Januar 2023 "Claudia Andujar. The Yanomami Struggle" gezeigt wird, und für die Triennale in Mailand nächstes Jahr im Juni.
Albert: In den westlichen Gesellschaften sind wir recht gut über die Katastrophen in der Welt informiert, doch wissen wir viel zu wenig über die Menschen, etwa im brasilianischen Regenwald, die davon betroffen sind. Die Kunst der indigenen Völker und Stämme, die vielfältig und eigensinnig ist, macht uns mit dem intellektuellen und ästhetischen Reichtum dieser Menschen bekannt. So verstehen wir den Verlust, den die Zerstörung ihres Lebensraums und ihrer Kultur bedeutet.
Wie dramatisch ist ihre Lage?
Albert: Ich arbeite seit mehr als 45 Jahren mit den Yanomami. So schlimm wie derzeit war die Situation noch nie. Sie brauchen dringend Unterstützung. Wir müssen mit allen Mitteln der Kunst, der Wissenschaft, der Literatur und natürlich der Politik über die Bedrohung informieren, der sie ausgesetzt sind, denn sonst werden sie vernichtet.
Was macht die Situation so gefährlich?
Albert: Zum ersten Mal bekennt sich eine brasilianische Regierung klar zu den illegalen Aktivitäten im Regenwald. Die Mafia wird eingeladen, sich zu bedienen: Illegale Goldsucher – das Gold geht nach Indien und in die Golfstaaten, wie Untersuchungen belegen –, illegale Holzfäller, illegale Jäger und Fischer. Neuerdings nutzt auch die Drogenmafia die illegale Ausbeutung des Amazonasgebiets, um ihre Gewinne zu waschen. Die Situation im Amazonasgebiet ist heute gefährlicher denn je. Präsident Jair Bolsonaro ist eine Art Wiedergänger des kolonialen Brasiliens. Wenn er spricht, glaubt man, die Portugiesen des 17. Jahrhunderts zu hören. Sein Ziel ist es, die Einheimischen zu töten, um das Land auszubeuten und seine Reichtümer zu stehlen.
Was geschah während der Corona-Epidemie?
Albert: Die Yanomami waren nicht so stark betroffen wie der Rest Brasiliens, weil sie vergleichsweise jung sind. Sie haben in der Vergangenheit viele Epidemien durchgemacht wie Masern oder Tuberkulose, die dazu führten, dass die Älteren starben.
Chandès: Als es losging, haben wir mit der Comissão Pró-Yanomami überlegt, wie wir helfen können. Cartier stellte den NGOs im Amazonasgebiet dann Masken, Desinfektionsmittel und Medikamente zur Verfügung, vor allem aber Geräte, die medizinischen Sauerstoff produzieren. Die NGOs vor Ort sind die einzigen, die sich um die Menschen im Amazonasgebiet kümmern.
Brigitte Werneburg ist freie Journalistin. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung von Amnesty International wieder.
ZU DEN PERSONEN
Leitet seit 1994 als Directeur artistique général alle Aktivitäten der Fondation Cartier, das Ausstellungsprogramm in Paris, das internationale Programm, die Sammlung und die Künstleraufträge.
setzt sich seit 1975 für die Yanomami ein. Er ist Autor zahlreicher Artikel und ethnografischer Bücher über die Yanomami, die Situation der indigenen Völker des brasilianischen Amazonasgebiets sowie über die Ethik der anthropologischen Forschung. 1987 trug er zusammen mit Claudia Andujar und Carlo Zacac zur Gründung der Comissão Pró-Yanomami bei.









