DEINE SPENDE KANN LEBEN RETTEN!
Mit Amnesty kannst du dort helfen, wo es am dringendsten nötig ist.
DEINE SPENDE WIRKT!
Abgeschoben und ausgeliefert
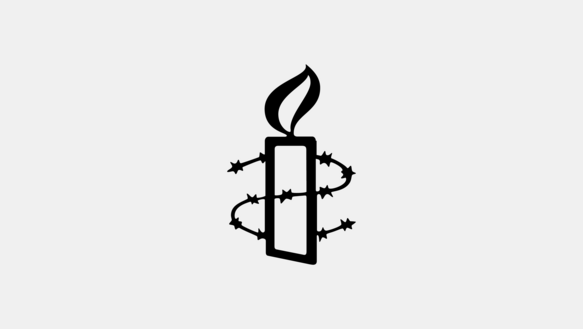
Trotz Pandemie und Bürgerkrieg werden weiterhin Menschen aus Europa nach Afghanistan zurückgeführt. Vor Ort gibt es viele Hilfsprogramme, aber kaum Perspektiven. Es drohen Verelendung und sogar der Tod.
Aus Kabul von Tamana Ayazi und Thore Schröder (Text) sowie Johanna-Maria Fritz (Fotos)
"Früher", sagt Ahmad Wali Naderi, "haben sie mich 'Tufan' gerufen, das heißt in unserer Sprache 'Wirbelwind'." Aber diese Zeiten seien lange vorbei. "Das war vor Deutschland", sagt er mit leiser Stimme, "Deutschland hat mich ruiniert." Naderi trägt eine schwarze Lederjacke mit Nieten, sein lockiges Haar fällt ihm ins Gesicht. Er ist erst 21 Jahre alt, doch stürmisch wirkt er nicht mehr, sondern vom Leben gezeichnet. Sein Blick irrt nervös durch den Raum, ständig entschuldigt er sich.
Seit dem 9. Oktober 2018 wohnt Naderi wieder bei seiner Familie, die in der Zwischenzeit von ihrem Dorf in der Provinz Pandschschir nach Kabul gezogen ist. An jenem 9. Oktober wurde er früh morgens in seinem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft im bayerischen Marktoberdorf von sieben Beamt_innen der Polizei geweckt. "Ich durfte nicht mal mein Telefon mitnehmen", erinnert er sich. Dann ging es zum Flugzeug. Ahmad Naderi wurde abgeschoben aus Deutschland, obwohl er kaum volljährig und nie kriminell war.
"Ich bin froh, dass ich nicht geisteskrank geworden bin. Vielen anderen geht es nicht so gut wie mir", sagt er und gießt grünen Tee nach. Das Wohnzimmer seines Zuhauses ist mit geblümten Kissen und geblümter Tapete eingerichtet. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinen drei Brüdern wohnt Naderi in einem einstöckigen Haus im Viertel Aria-City, ganz in der Nähe der Puder-Straße, die selbst im unsicheren Kabul berüchtigt ist für finstere Gestalten aus dem Drogenhandel.
Terror in Kabul
Seit Dezember vergangenen Jahres schieben einige Bundesländer wieder nach Afghanistan ab, obwohl es laut Global Peace Index das gefährlichste Land der Welt ist. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung ausgesprochen und deutsche Staatsangehörige aufgefordert, Afghanistan zu verlassen. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatte Deutschland die Rückführungen nach Kabul zunächst ausgesetzt. Mehrere Verwaltungsgerichte stellten fest, dass dort Verelendung droht, und die Weltbank konstatierte, dass die Armutsquote infolge der Pandemie auf über 70 Prozent gestiegen ist.
Zudem besteht die Gefahr, dass der Bürgerkrieg im Land weiter eskaliert. Die Taliban sagten im April ihre Teilnahme an einer geplanten Friedenskonferenz erstmal ab und zeigen sich – nicht erst seit der Ankündigung der USA und ihrer Verbündeten, ihre Truppen bis Mitte September abzuziehen – extrem selbstbewusst. Auch die Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung sind festgefahren. Die Taliban und der Islamische Staat (IS) machen Jagd auf Politiker_innen, Sicherheitskräfte, Aktivist_innen und Journalist_innen.

Alltag in Kabul: Ahmad Wali Naderi zu Hause.
© Johanna-Maria Fritz
Nicht nur in Kabul explodieren täglich Haftminen unter Autos, werden Busse in die Luft gesprengt und Menschen erschossen. Allein im März fielen 305 Menschen dem Terror zum Opfer, 350 wurden verletzt, die Angriffe nahmen im Vergleich zum Februar um 20 Prozent zu. "Ich muss jeden Tag zweimal die Stadt durchqueren", sagt Ahmad Wali Naderi, er könne sich ja nicht ständig zu Hause verstecken.
Als 15-Jähriger war er aus seinem Dorf nach Deutschland aufgebrochen. "Ich war gut in der Schule, ich wollte nicht weg", sagt er. Doch sein Vater, der beim Geheimdienst arbeitet, hatte Todesdrohungen erhalten, die sich gegen die ganze Familie richteten. Anfang 2016 kam der unbegleitete Minderjährige in Bayern an. Er lernte Deutsch und bekam einen Ausbildungsplatz in einem Sportgeschäft im ostallgäuischen Seeg angeboten.
Doch die Mühe war vergeblich, nach seinem 18. Geburtstag wurde sein Asylantrag endgültig abgelehnt. "Die Gründe kenne ich bis heute nicht", sagt er. Die Zeit in Deutschland habe ihm nicht genutzt, sondern geschadet: "Alle hatten auf mich gesetzt, doch dann kam ich mit leeren Händen zurück." Der Druck der Familie und das Gerede der Nachbarn waren zu viel, Naderi bekam Ausschlag am ganzen Körper. "Und ich habe kaum mehr geschlafen."
"Einfach rausgestrichen"
Anfang 2020 nahm er an einem Fortbildungskurs zum Marketingfachmann teil, der von der deutschen Welthungerhilfe finanziert wurde, um endlich einen Job in Kabul zu finden. Doch auch dieser Versuch war erfolglos. "Deshalb bin ich vor fünf Monaten wieder los, dieses Mal wollte ich nach Großbritannien", erzählt Ahmad Wali Naderi. Er kam nur bis zur iranisch-türkischen Grenze, wurde dort aufgegriffen und zurückgeschickt.
Nun fährt der junge Mann wieder jeden Tag mit dem Sammeltaxi durch die Stadt, um sich weiter ausbilden lassen, um irgendwann vielleicht doch noch einen Job zu finden und eine bescheidene Existenz aufzubauen. "Diese jungen Männer müssen irgendetwas machen, um nicht die Hoffnung zu verlieren", sagt Sharif Hasanzadar. Er ist Gründer und Direktor der Better Makers Social Organisation (BMSO), einer NGO, bei der Naderi nun lernt, wie man Mobiltelefone repariert. Der Kurs dauert fünfeinhalb Monate, drei Stunden täglich. Über Hasanzadars Schreibtisch im ersten Stock eines Gebäudes nahe der Kabuler Universität klebt ein Poster: "I like nonsense. It wakes up my mind" ("Ich mag Unsinn. Er weckt meinen Geist").
Die Arbeit von BMSO begann 2014 in Mazar-i-Sharif im Norden des Landes. "Angefangen haben wir mit Straßenkindern", sagt Hasanzadar, "vor zwei Jahren ging es mit Rückkehrern los." Seit 2015 kommt das Geld für die Arbeit der BMSO von der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Die Abgeschobenen kämen "frustriert zurück", sagt der Direktor: "Viele sind deprimiert oder nehmen Drogen. Der Kulturschock ist gewaltig."
Als der Workshop im Erdgeschoss unterbrochen wird, kommt in der Runde kurz Stimmung auf. Die jungen Männer legen Lötkolben und Platinen zur Seite, um zu überlegen, welches Schicksal aus ihrer Mitte besonders beklagenswert ist. Eher widerwillig wagt sich der 23-jährige Hamayoun Sawari nach vorne. Seine Familie gehört zur schiitischen Minderheit der Hazara, die in Afghanistan seit langem verfolgt wird. Das Haus der Sawaris in der Provinz Wardak wurde von Nomaden attackiert, die ihnen ihr Land abspenstig machten. In Afghanistan kann der Staat vielerorts nicht einmal die Lebensgrundlagen seiner Bürger_innen beschützen.
In Sachsen gestrandet
Deswegen ging Sawari 2015 nach Europa. Er wollte nach Schweden, blieb aber in Deutschland hängen. Knapp 8.000 Dollar hatte die Familie für die Flucht des ältesten Sohnes aufbringen müssen. Ausgerechnet im sächsischen Teil des Vogtlands, das wegen vieler Neonazis berüchtigt ist, fasste er Fuß. "Wenn man Afghanistan überlebt hat, muss man sich vor denen nicht fürchten", sagt Hamayoun Sawari.
Tatsächlich fand der damals gerade Volljährige schnell Anschluss in Sachsen. "Mein Asylantrag wurde schon nach fünf Monaten abgelehnt, aber meine Freunde sagten, mir könne nichts passieren, wenn ich mich weiter an die Regeln halte." Sawari hatte in einer Großbäckerei im Nachbarort einen Job gefunden. Von einem Kollegen kaufte er für 80 Euro ein rotes Fahrrad, weil der Bus am frühen Morgen so selten fuhr.
Die Personalleiterin der Bäckerei kann sich noch gut an den afghanischen Mitarbeiter erinnern: "Er war so herzlich, fleißig und wir hatten sogar darüber gesprochen, dass er eine Ausbildung bei uns machen kann." Doch dann kamen im Spätsommer 2018 zwei Polizeibusse in den Betrieb, um ihn zu holen. Sawari bekam keine Gelegenheit, seine Sachen zu packen oder auch nur sein verdientes Geld vom Konto abzuheben. "Einfach nur rausgestrichen", habe man ihn, sagt die Personalleiterin. "Aber sein Fahrrad wartet auf ihn, und die Tür steht bei uns immer offen."
Schon zweimal überfallen
In Afghanistan hatte niemand Verwendung für Hamayoun Sawari, auch wurde seine Familie weiter bedroht. Deshalb verließ er das Land bald erneut und floh in den Iran: "Dann kam Covid, und es hieß, wir Afghanen bekämen dort keine Behandlung. Also ging ich notgedrungen zurück." In Kabul arbeitet er seit sieben Monaten als Lieferant für ein Schnellrestaurant. Seine Schicht dauert täglich von fünf Uhr nachmittags bis sechs Uhr früh. Nachts traut sich kaum jemand auf die Straßen. "Mir aber bleibt keine Wahl, tagsüber muss ich zum Kurs", sagt Sawari, während er seine zitternden Hände an einem Heizstrahler wärmt.
Der Lohn sei schlecht, erzählt er, maximal 170 Euro im Monat. Und das auch nur, wenn er nicht überfallen wird: "Zweimal schon haben sie mich gestoppt. Beim ersten Mal hielten sie mir eine Pistole an meinen Kopf, beim zweiten Mal ein Messer an meinen Bauch." Das geraubte Geld, umgerechnet 56 Euro, zog ihm sein Chef vom Gehalt ab. Einmal entkam Sawari einem Bombenanschlag um wenige Sekunden. "Aufgeben kann ich den Job nicht", sagt er, "wie sollte ich dann überleben?"
"Den Abgeschobenen wird gesagt, dass sie ihr Leben riskieren müssen", stellt Shaharzad Akbar fest. Die Vorsitzende der Unabhängigen Menschenrechtskommission Afghanistans wird schon lange mit dem Tode bedroht, sie ist rund um die Uhr von schwer bewaffneten Männern umgeben. Mit ihrem Mann und ihrem knapp zweijährigen Sohn lebt sie gezwungenermaßen wie eingesperrt.
20 Jahre nach dem Sturz der Taliban gleicht Kabul vielerorts mehr einer modernen Festung als einer Stadt. Botschaften, Ministerien, Stiftungsbüros und Hilfsorganisationen schützen sich mit hohen Betonmauern, Stacheldraht, Überwachungskameras, Checkpoints und Sicherheitsschleusen. Große Teile der Hauptstadt, allen voran die zentral gelegene Green-Zone, wirken wie herausgeschnitten. Der überwiegende Teil der 4,4 Millionen Einwohner_innen kann diesen Teil der Stadt nicht betreten.

Ohne klare Perspektive: Latif Mohammadi in Kabul, März 2021.
© Johanna-Maria Fritz
Trotz Pandemie wurden im vergangenen Jahr 137 Menschen aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben. Als Integrationshilfe erhalten sie von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) am Flughafen 12.500 Afghani, rund 136 Euro. Bei Bedarf werden sie für mindestens eine Woche in einem Hotel im Zentrum untergebracht.
Latif Mohammadi hat es nach seiner Abschiebung am 17. Dezember 2020 vorgezogen, zu entfernten Verwandten zu ziehen. Es war einfacher, sich dort an das Land zu gewöhnen, das er nur aus Erzählungen kannte. Noch im Säuglingsalter waren seine Eltern mit ihm nach Pakistan geflohen. Als nicht anerkannter Flüchtling durfte er im Nachbarland nie eine Schule besuchen. Als er elf war, nahm ihn sein Onkel mit in den Iran, dort blieb er zwei Jahre und kam dann nach mehrjähriger Flucht eher zufällig nach Deutschland. Im Saarland machte er seinen Hauptschulabschluss, absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer psychiatrischen Klinik und begann anschließend eine Krankenpflegeausbildung.
Abschiebung nach Haftstrafe
Das alles erzählt der 24-Jährige in fast akzent-, aber nicht dialektfreiem Deutsch. Ja, sagt Mohammadi, er könne "gut schwätzen". Über das Haus, in dem er lebt, fliegt ein Hubschrauber, die Zufahrtstraße ist nicht geteert, in der Mitte verläuft ein Graben, durch den Abwasser fließt. Der junge Mann mit den blauen Augen und der saarländischen Mundart erzählt, dass sein Vater in Pakistan an Krebs gestorben sei: "Und dann wurde mir alles zu viel." Wegen eines Burnouts musste er seine Lehre abbrechen und fand keinen Halt mehr. "Was dann passiert ist, werde ich mein Leben lang bereuen": eine Schlägerei mit einem anderen Afghanen, die mit einem Messerstich endete. Nach zweieinhalb Jahren Haft wurde Mohammadi schließlich abgeschoben. "Ich habe meine Strafe abgesessen. Ich bin doch viel mehr als nur diese Tat", sagt er.
Auf dem Abschiebeflug hatte er Angst "vor diesem Land, das ich nicht kannte". Auch ein Vierteljahr später verlässt er das Haus seiner Verwandten nur selten. Das Begrüßungsgeld ist längst aufgebraucht, bei einer Hilfsorganisation für Rückkehrende habe er ergebnislos vorgesprochen. Für elf Stellen hat er sich schon vergeblich beworben, ohne Beziehungen oder Bestechung hat er keine Chance. "Wie es weitergehen soll, weiß ich nicht", sagt Mohammadi, "vielleicht muss ich bald wieder gehen."
Tamana Ayazi und Thore Schröder sind freie Journalist_innen,Johanna-Maria Fritz ist freie Fotografin. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung von Amnesty International wieder.









